Mit seinem 1859 erschienenen Hauptwerk „On the Origin of Species“ (Über die Entstehung der Arten) hat der britische Naturforscher Charles Darwin die Grundlage für die moderne Evolutionstheorie geschaffen. Danach erweisen sich bestimmte im Erbgut von Organismen auftretende Veränderungen, die diese an ihre Nachkommen weitergeben, als günstig.
Das heißt: Veränderungen beziehungsweise Merkmale setzen sich durch, weil sie bei den herrschenden Umweltbedingungen Vorteile bieten. Bei Gräsern kann die Anpassung auch ohne entsprechendes Erbgut von Vorfahren gelingen. Wie ist das möglich?
Antwort: Darwin ging zwar von erblichen Unterschieden aus, wusste aber noch nichts von den heute bekannten Details der Vererbung. Beim Erbgutträger in Zellen handelt es sich um Desoxyribonukleinsäure (DNA), und die Arbeitsanweisung für die Herstellung von Eiweißstoffen (Proteinen), das heißt Grundbausteinen von Zellen, liefern Abschnitte davon, die Gene. Diese entscheiden zum Beispiel darüber, welche Augenfarbe oder Blutgruppe ein Mensch hat. Gene bestehen aus einer charakteristischen Abfolge von Basenpaaren. Die Evolution beziehungsweise Entwicklung von Arten ist möglich, weil Basen zufällig ausgetauscht sein können und dieser Austausch sich als vorteilhaft erweist. Solche Veränderungen im Erbgut werden als Mutationen bezeichnet. Mutationen in Keimzellen werden an Nachkommen weitergegeben.
Wenn Erbgut bei einer Art von Lebewesen von einer Generation zur nächsten gelangt, verbinden Fachleute dies mit dem Begriff vertikal. Vergleichsweise jung ist die Erkenntnis, dass es auch einen sogenannten horizontalen Gentransfer gibt. Das bedeutet: Gene können von einem Organismus auf einen bereits vorhandenen anderen Organismus, der sogar einer anderen Art angehören kann, übertragen werden. Eine neue Studie liefert Belege dafür, dass der horizontale Gentransfer für die Anpassungsfähigkeit von Gräsern eine Rolle spielt.
Die internationale Forschergruppe um Luke T. Dunning von der britischen University of Sheffield hat das Erbgut des in tropischen und subtropischen Gebieten Afrikas, Asiens und Australiens verbreiteten Wildgrases Alloteropsis semialata untersucht und dabei festgestellt, dass es fast 60 von anderen Gräsern übernommene Gene enthält. Diese Gene stammen von mindestens neun anderen Grasarten und wurden ohne Fortpflanzung direkt von Gras zu Gras übertragen, wie die Experten im Fachjournal „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften erklären. Nach den Worten des Pflanzenforschers Professor Christian Parisod von der Universität Bern, der zu den Autoren der Arbeit gehört, zeigen die Ergebnisse, dass sich einige Pflanzen dank der Gene von mehr oder weniger nahe verwandten Arten relativ schnell an Umweltveränderungen anpassen können. So stießen die Wissenschaftler bei den auf das Wildgras Alloteropsis semialata übertragenen Genen auch auf Bauanleitungen für Eiweißstoffe, die für die Widerstandskraft gegen bestimmte Krankheiten und die Anpassung an Bodenverhältnisse wichtig sind.
Die Forschung der vergangenen Jahre hat Hinweise geliefert, dass der horizontale Gentransfer in der Natur alles andere als selten vorkommt. Vor allem bei Bakterien scheint er häufig aufzutreten. Dass es ihn auch bei Pflanzen gibt, zeigt nicht nur die jetzt vorgestellte Untersuchung, sondern zum Beispiel auch eine Studie, die 2017 von einer Forschergruppe um Vaclav Mahelka vom Botanischen Institut der tschechischen Akademie der Wissenschaften im Fachjournal „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften veröffentlicht worden ist. Die Experten hatten genetisches Material von 25 Pflanzenarten untersucht, darunter vor allem Arten der Gattung Gerste. Bei 16 Arten fanden sie Material, das von verschiedenen Arten einer als Panicoideae bezeichneten Unterfamilie der Süßgräser stammt. Zu dieser Unterfamilie gehören zum Beispiel auch Kulturarten wie Mais, Zuckerrohr und Hirse.
Die Fähigkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, ist für das Überleben von Arten von entscheidender Bedeutung. Darwins berühmte Formulierung „survival of the rittest“ bedeutet, dass die am besten angepassten Individuen überleben. Viele Nachkommen von Lebewesen sterben noch vor der Geschlechtsreife. Aus dieser Tatsache zog Darwin den Schluss, dass es erbliche Unterschiede gibt, die sich positiv oder negativ auswirken können. Er ging davon aus, dass am Ende diejenigen überleben und sich vermehren, die gut an die herrschenden Bedingungen angepasst sind. Welche Veränderungen in Organismen sich durchsetzen, hängt von der natürlichen Auslese ab, der sogenannten Selektion.



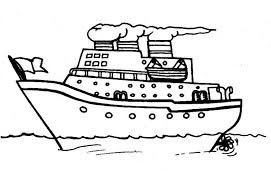

Hinterlasse jetzt einen Kommentar