Zu den Grundeigenschaften von Lebewesen gehört, dass sie für Nachkommen sorgen und so den Fortbestand der eigenen Art sichern.
Die Art und Weise, in der dies geschieht, kann allerdings sehr unterschiedlich sein. Wissenschaftler nehmen an, dass sich Lebewesen auf der Erde zunächst durch Teilung oder Bildung eines Sprosses fortpflanzten, das heißt ungeschlechtlich oder asexuell. Erst später entwickelte sich demnach die geschlechtliche, die sexuelle Fortpflanzung. Worin liegen aus biologischer Sicht die Vorteile dieser Fortpflanzungsart?
Antwort: Biologen nehmen an, dass die Ursache für den Erfolg der sexuellen Fortpflanzung in der größeren Variabilität liegt, das heißt in der Möglichkeit, mehr unterschiedliche Nachkommen hervorzubringen, die sich bei unterschiedlichen Lebensbedingungen behaupten können. Außerdem wird durch diese Art der Fortpflanzung verhindert, dass sich im Laufe der Zeit immer mehr schädliche Mutationen ansammeln, dass immer mehr Veränderungen von Genen auftreten, die sich für die Lebewesen als Nachteil erweisen. Zu den Folgen solcher Veränderungen können Funktionsstörungen in Geweben und die Entstehung von Tumoren gehören.
Worauf die Variabilität beruht, lässt sich leicht nachvollziehen, wenn man sich bewusst macht, was mit dem Erbgut geschieht, wenn sich Lebewesen wie Menschen sexuell fortpflanzen. Damit Zellen Eiweißstoffe herstellen, die unter anderem als Baumaterial dienen, müssen sie entsprechende Arbeitsanweisungen erhalten. Diese werden von den Genen in der DNA (Desoxyribonukleinsäure) geliefert. Dieser Erbgutträger befindet sich in den Kernen menschlicher Körperzellen und zwar aufgeteilt in 46 kleinere Gebilde, die Chromosomen. Sie stammen je zur Hälfte von der Mutter und vom Vater. Mit anderen Worten: Erst durch die Verschmelzung einer Ei- und einer Samenzelle mit ihren jeweils 23 Chromosomen entsteht eine Körperzelle mit 46 Chromosomen.
Daraus folgt zugleich, dass im Körper geschlechtsreifer Menschen der Chromosomensatz bei der Herstellung der Ei- und Samenzellen halbiert werden muss. Dies geschieht in den Eierstöcken und Hoden. Dabei besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, die jeweils 23 Chromosomen von der Mutter und vom Vater neu zu kombinieren. Genau genommen sind es zwei hoch 23, also mehr als acht Millionen. Verschmelzen eine Ei- und eine Samenzelle, beträgt die Menge an möglichen Kombinationen zwei hoch 23 mal zwei hoch 23, das heißt mehr als 70 Billionen. Sprich: Die Variabilität ist unvorstellbar groß.
Auch Blütenpflanzen sichern den Erhalt ihrer Art mithilfe der geschlechtlichen Fortpflanzung. Die Blüten bestehen aus unterschiedlichen Arten von Blättern: den gewöhnlich grünen Kelchblättern, die die Blüte umschließen, bevor sie sich öffnet, den meist auffällig gefärbten Kronblättern, den Staubblättern, wo Pollenkörner produziert werden, und den Fruchtblättern, an deren Spitze sich die klebrige Narbe befindet, die die Pollenkömer aufnimmt. Die Narbe ist mit dem Fruchtknoten verbunden, der die Samenanlage umschließt und schützt. Nach der Befruchtung entwickelt sich diese Anlage zum Samen. Früchte sind reife Fruchtknoten. Bestäubung bedeutet, dass Pollenkömer der Staubblätter, der männlichen Fortpflanzungsorgane, auf die Narbe des weiblichen Fortpflanzungsorgans übertragen werden. Einige Pflanzen sind Selbstbestäuber, die meisten jedoch sind auf die sogenannte Fremdbestäubung angewiesen, das heißt: Pollen einer Pflanze gelangen zur Narbe einer anderen derselben Art. Bei der Bestäubung spielen nicht nur Insekten wie Bienen oder Käfer eine Rolle, sondern zum Beispiel auch Vögel.
Es gibt auch Pflanzenarten, bei denen sich aus einem Teil, etwa aus der Wurzel oder dem Stängel, eine neue Pflanze entwickelt. Diese Lebewesen liefern Beispiele für die ungeschlechtliche Fortpflanzung. Dass auch dieses Verfahren erfolgreich ist, beweisen nicht zuletzt die Bakterien, die sich selbst unter extremen Bedingungen behaupten können. Bakterien pflanzen sich fort, indem sich ihre Zellen teilen. Bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung werden Klone erzeugt, genetisch identische Lebewesen. Die Tochterzellen haben das gleiche Erbgut wie der elterliche Organismus.
Auch das Tierreich liefert Beispiele für die asexuelle Fortpflanzung. So entstehen bei Süßwasserpolypen die Nachkommen aus sich teilenden Zellen am Muttertier. Eine Forschergruppe von der Universität Göttingen hat im Fachjournal „Nature Communications“ eine Studie veröffentlicht, die sich mit im Boden lebenden Arten von Hornmilben befasst. Diese Tiere pflanzen sich seit Millionen Jahren asexuell fort und schaffen es offenbar auch unter dieser Voraussetzung, die Anhäufung schädlicher Mutationen zu vermeiden.




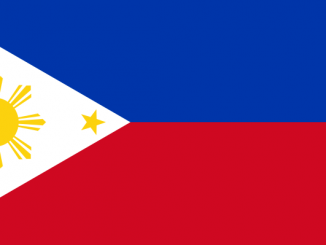
Hinterlasse jetzt einen Kommentar